Als Mitherausgeberin einer wissenschaftlichen Zeitschrift ZEL (Zeitschrift für E-Learning, Lernkultur und Bildungstechnologie), die der Studienverlag in vier Themenheften pro Jahr im Druck produziert und vertreibt, befasse ich mich mit der Frage, wie ein „Open Access„-Modell umgesetzt werden kann. Dass die wissenschaftlichen Artikel entgeltfrei, online und sofort mit ihrem erstmaligen Erscheinen zur Nutzung verfügbar sind, wird als Erwartung an uns Herausgeber herangetragen, teils verbunden mit Enttäuschung oder sogar Entrüstung, dass dies zur Zeit nicht selbstverständlich der Fall ist.
Natürlich ist es erstrebenswert, dass die Nutzung von Bildungsressourcen mit möglichst geringen Barrieren und idealerweise unentgeltlich möglich ist – und wo immer mir das leicht möglich ist, mache ich aktiv mit (meine Blogposts, Präsentationen auf Slideshare, Projektberichte auf Calameo, Wissenscommunities wie WissensWert Blog Carnival u.a.m. sind frei verfügbar).
Hinter jedem Produkt steht jedoch ein Produktionsprozess, der Kosten und Zeitaufwand verursacht – und eine wissenschaftliche Zeitschrift ist nicht kostenlos machbar, selbst wenn die Arbeit von Herausgebern, Autoren und Gutachtern ohnehin schon ohne spezielle Vergütung, „ehrenhalber“ geleistet wird. Kosten müssen durch Erlöse mindestens gedeckt werden, sonst kann das Produkt über kurz oder lang nicht mehr angeboten werden. Wenn die Erlöse nicht von Abonnement-Einnahmen kommen, dann müssen es andere Erlösquellen sein, mir fallen ein: Spenden, Sponsoring, indirektes Sponsoring durch Mischkalkulationen, Werbeeinnahmen, Mitgliedsbeiträge bei Zeitschriften von Fachgemeinschaften, Pay-per-View-Modelle, Einreiche- und Publikationsgebühren für die Autoren. Traditionell übernimmt ein Verlag die unternehmerische Aufgabe und das Risiko, Kosten und Erlöse mindestens zur Deckung zu bringen. Ausserdem steht der Verlag auch für Rechtsfolgen ein, wenn das nicht gelingt; der Verlag ist auch Organisator und Anspruchsgegner in rechtlichen Belangen.
Wenn ein Verlag nun nicht auf das Open Access Modell einsteigen will, wie soll dann der Herausgeberkreis den Leserinnen und Lesern entsprechen, die unentgeltliche Nutzung fordern? Entweder a) man findet einen anderen Verlag, der in Open Access eine Marktchance sieht, zahlt für die Zeitschrift eine Ablösesumme oder man gründet neu. Vielleicht b) übernimmt man dann selbst das Verlagsgeschäft. Oder c) man beschafft das Geld für den Verlag, damit dieser bereit ist, Open Access zu publizieren, wenn es zu entgangenen Erlösen und Zusatzaufwand kommt. Wer wird unumwunden für b) oder c) votieren, wo die Aufgabe der wissenschaftlichen Herausgeber doch ist, für die Inhalte und deren Qualität besorgt zu sein und sich nicht mit Operativem herumschlagen zu müssen?
Man könnte noch d) hinzufügen, dass die Bedeutung der Openness-Bewegung überhaupt darin zu sehen ist, die Publikation und Kommunikation wissenschaftlicher Erkenntnisse grundlegend zu innovieren, d.h. das Modell wissenschaftlicher Zeitschriften der heutigen Prägung wäre überhaupt in Frage zu stellen. Ja, die Strategiegestaltung und Innovation liegt in der Verantwortung der Herausgeber. Das sei jedoch jetzt noch nicht weiter ausgeführt, denn Auslöser meines Blogposts hier sind nicht eine Fülle von Ideen von Leser/inn/en und Autor/inn/en, was zu verbessern wäre, sondern es ist der Anspruch „entgeltfreie Nutzung“.
Aber nun zu der Kostenstruktur: Eine wissenschaftliche Zeitschrift ist ein Produkt, hinter dem ein recht komplizierter Wertschöpfungsprozess steht, an dem mehr Beteiligte mitwirken als man auf den ersten Blick denkt. Die nicht eigens vergüteten Organisationsleistungen der Herausgeber für die Zeitschrift sind beträchtlich. Weiterhin durchläuft jeder einzelne – auch nicht-veröffentlichte – Artikel einen arbeitsaufwendigen ebenfalls ohne separate Vergütung erbrachten Veredelungsprozess (Verfassen der Beiträge – Auswahlprozess unter Einreichungen von Abstracts – Begutachtung i.V.m. Verbesserungshinweisen durch mehrere Personen – Sichtung der überarbeiteten Version und schliesslich das Management eines Heftprojekts als solches); wissenschaftliche Artikel sind also nicht damit vergleichbar, einen Blog-Post zu schreiben oder Vortragsunterlagen auf einer offenen Plattform verfügbar zu machen. Es gibt bezahlte Dienstleistungen in diesem Prozess (Website/Webplattform betreuen, redaktionelle Überarbeitung der Beiträge inkl. ansprechendes Layout, Marketing für die Zeitschrift, allg. Sekretariatsarbeiten und Reisespesen), die dazu führen, dass man im Fall von Autorengebühren-Modellen kalkuliert, dass ein Artikel einige wenige Hundert bis 2000 EUR kosten müsste. Das klingt nach nicht viel Zusatzaufwand für die Herausgeber, dies auch noch zu besorgen. In der Praxis heisst dies aber oft, man muss zum einen an der eigenen Hochschule Zusatz-Budgets für diese Dienstleistungen heraushandeln und zum anderen Anerkennung für diesen Zeitaufwand gewinnen, denn der Druck auf Hochschullehrer, die Zeit in eigene Journalpublikationen und Forschungsmittel-Akquise zu investieren führt zu um die Zeitressourcen stark konkurrenzierenden Anforderungen.
Mein Stand des Denkens: Verlage und Herausgeber müssen mit der Zeit gehen und auch mal experimentieren, um Systemveränderungen einzuleiten; aber sie sollen auch nichts überstürzen, insbesondere nicht die kaufmännische Sorgfalt ausser Acht lassen. Sonst geht die Zeitschriftenkrise bei den Printpublikationen nahtlos in eine Open-Access-Zeitschriftenkrise über. Solange das Konzept „Open Access“ hauptsächlich im Sinn von „toll ein anderer zahlt und macht“ (Anm. Team-Arbeit wird spöttisch oft als toll-ein-anderer-machts interpretiert) gefordert wird und nicht so verstanden wird, dass ein komplexes Gefüge wie das wissenschaftliche Publikationswesens, inklusive dessen Rolle in der Qualifizierung für wissenschaftliche Karrieren, zeitgemäss und stimmig neu gestaltet werden muss, bevorzuge ich, schrittweise, mit Bedacht und mit kaufmännischer Vorsicht vorzugehen. Schrittweise, weil ich David Wileys Artikel „Defining Open“ auf seinem Blog „iterating toward openness – pragmatism over zeal“ zustimme, dass Openness nicht heisst, entweder offen oder geschlossen, sondern es sich so verhält wie bei einer Türe, die mehr oder weniger offen stehen kann. Auch kann man eine Entwicklung beobachten, dass in der Wissenschaft besondere Leistungen separat vergütet werden sollen, so dass die „unentgeltlichen“ Arbeiten in der Organisation des wissenschaftlichen Publizieren vielleicht zurückgehen werden. Und schliesslich wird das Prinzip der kaufmännischen Vorsicht aus meiner betriebswirtschaftlichen Ausbildung meiner Überzeugung nach auch im Zeitalter des Offenen Internet noch gelten, auch wenn ich mit dem Beitrag von Google „The Meaning of Openness“ (vom 21.12.09) übereinstimme, in dem es u.a. heisst, dass das MBA-Curriculum neu geschrieben werden würde.
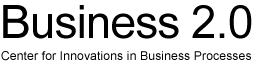
 Beiträge per RSS
Beiträge per RSS
23. Dezember 2009 um 17:45
Vielen Dank für Deinen Beitrag. Ich freu mich darüber, dass jemand, den es konkret betrifft, als Autor, als Reviewer, als Herausgeber, als Hochschullehrer, sich zur gesamten Komplexität des OA äussert. Die OA Diskussion ist aus meiner Sicht viel zu oft auf einer zu abstrakten Ebene; die oft viel zu politische und bisweilen polemische Diskussion hilft uns auf der Indianerebene nicht wirklich weiter. Und die OA Welt ist eben viel komplexer und differenzierter als viele Diskussionen dies widerspiegeln, schwarz-weiss Malen ist ja auch viel einfacher – ich habe mich ja auch schon dazu geäussert.
23. Dezember 2009 um 18:11
[…] Teils unserer Diskussionen ausformuliert – nämlich die Frage nach den Kosten (nachzulesen hier). In ihren Erläuterungen wird auch dargetsellt, warum es mit dem Open Access nicht so simpel ist, […]
23. Dezember 2009 um 18:13
Hallo Andrea,
das ist eine gute Zusammenfassung unserer Diskussionen zum Thema „Kosten“. Ich kann das alles nur unterstreichen. Siehe auch: http://gabi-reinmann.de/?p=1644
Gabi
24. Dezember 2009 um 10:10
Dass es mit dem „free“-Geschäftsmodell alleine nicht getan ist, zeigt sich z.B. auch daran, dass selbst der Autor von „Free“, Chris Anderson, sein Buch zwar zum freien Download anbietet, aber sich seine Buchpräsentationen und Panel-Diskussionen fürstlich entlonen lässt.
Ich finde dass hier ist ein gutes Beispiel dafür, dass alle Zeitschriften, egal in welcher Auflage sie erscheinen, durch den „free“-Gedanken den gleichen Problemen unterliegen. Anscheinend muss heutzutage beim Leser im Kopf eine „free“-Wahrnehmung entstehen, sonst ist das Angebot nicht am Puls der Zeit. Die Monetarisierung funktioniert daher derzeit nur über den Umweg komplementärer Angebote.
28. Dezember 2009 um 21:29
Ich denke, in dieser Diskussion werden die Prioritäten fast schon absurd falsch gesetzt. Die Arbeitszeit (oder Freizeit) von hochbezahlten Spezialisten wird wie selbstverständlich nicht eigens entlohnt – die Gründe werden hier nicht hinterfragt, sind aber wohl vielfältig und reichen von schnöder Reputationssteigerung bis zur Begeisterung für die wissenschaftliche Sache oder gar Altruismus. Die bezahlte, vergleichsweise kürzere Arbeitszeit von vergleichsweise erheblich weniger teuren und spezialisierten Personen (Sekretär, Lokomotivführer, Webdesigner für kleines Standard-Projekt von der Stange) führt aber nun dazu, dass die Ziele der kostenlos arbeitenden „teuren“ Wissenschaftler nicht in optimaler Weise erreicht werden.
Selbst wenn man davon ausginge, dass die nicht bezahlten Arbeiten der Autoren in deren Arbeitszeit verrichtet werden, also der Staat und damit der Steuerzahler die Beteiligten am Peer Review bereits durch Beamtenbezüge etc. entlohnt, geht diese Betrachtungsweise auf. Ziele des Staates für diese Entlohnung sind Hebung der Bildung, Förderung der Wissenschaften, Wirtschaftsförderung, etc. Nun könnte man mit vergleichsweise sehr wenig zusätzlichem Steuergeld die Zielerreichung durch kostenfreien Zugang vervielfachen. Wegen ein paar Bahntickets, Briefmarken und Website-Arbeiten wird aber darauf verzichtet. Das ist aber eine, mit Verlaub, reichlich dumme Allokation von Ressourcen.
Bei Zeitschriften, die hauptsächlich von staatlichen bzw. staatlich geförderten Organisationen bezogen werden, kommt noch hinzu, dass der Staat an anderer Stelle, nämlich bei den Bibliotheken, sogar noch erheblich Steuern spart, und das mehr als vorher ausgegeben wurde, denn die Verlagsgewinne fallen ja weg. Und die sind bei den wissenschaftlichen Monopolisten zum Teil exorbitant. Nur wenn der „staatliche“ Selbstverlag immens höhere Kosten als ein durchschnittlicher Verlag hat, geht das nicht auf.
Bei weltweiten Datenbanken und Zeitschriftenprojekten zu großen Wissenschaftsgebieten mag das passieren. Aber bei einer kleinen deutschsprachigen Zeitschrift? Das klingt ein bisschen nach Größenwahn. Ich denke, keiner der Leser, die von einer Zeitschrift für E-Learning auch schnelle und einfache E-Verfügbarkeit fordern, wird sich auch nur einen Moment lang Gedanken darüber machen, ob das Layout der letzte Schrei ist. Weniger formeller Aufwand für weniger Geld ist da oft mehr und wird nicht als störend empfunden.
28. Dezember 2009 um 21:59
Ich kann Herrn Buchhändler Praefcke da nur sekundieren. Der Beitrag ist ein Beispiel kläglich ökonomistischer Verkürzung. Dass es grundfalsch ist, Zeitschriften wie „Science“ und kleine Zeitschriftenprojekte in einen Topf zu werfen, habe ich wiederholt unterstrichen:
http://archiv.twoday.net/search?q=open+access+low+budget
Wozu braucht man ein teures Marketing? „Open Access“ wäre das beste Marketing, denn der/die/das Citation Advantage ist bislang unwiderlegt.
Es wäre zu wünschen, dass sich ZeitschriftenherausgeberInnen fundiert und seriös und mit Anstrengung auf das höchst umfangreiche Open-Access-Schrifttum einlassen statt dümmliche Sprechblasen abzusondern.
28. Dezember 2009 um 22:17
Sie sprechen bzw. schreiben es aus, was mir auch bei der Aufwandsposten-Rechnerei durch den Kopf ging. Obwohl mir die Grössenverhältnisse der geldwerten Leistungen bewusst sind, meldet mein Gefühl (= gesammelte Erfahrung), dass trotzdem noch etwas zur uneingeschränkten SOFORT-Los-Damit-Energie fehlt. Aber was ?
Ich bin noch dabei, das Gefühl zu analysieren …
Vermutung 1: Wo immer man Geld beschaffen muss, auch wenn es wenig ist, ist das eben eine Barriere: Noch existieren kostenlose Verlagsdienstleistugen an Hochschulen ja nicht selbstverständlich, so dass man nur dahin ausweichen müsste. (Und hierzulande würde man auch innerbetriebliche Verrechnungspreise für solche Leistungen zahlen müssen, erwarte ich).
Vermutung 2: Die menschliche Zueigung zu diesem Sinnspruch, den man nur zu oft wünscht, beherzigt zu haben, wenn man mit IT oder E- zu tun hat: „Never change a running system“.
Vermutung 3 ist, dass ich finde für Leistungen (warum nicht auch die der diese Aufgabe wahrnehmenden Wissenschaftler?) sollte Geld transparent fliessen, direkt als Entscheidungsakt zwischen den am Austausch Beteiligten – als Ausdruck der Wertschätzung. Dafür wurde Geld erfunden. Muss man denn Geldtransaktionen krampfhaft vermeiden? Die Abwicklung von Micropayments wird ja auch zunehmend einfacher. Und überall, wo etwas „kostenlos“ ist, kommt es ja auch zu Verschwendung (z.B. E-Mail-Spam) und Fehlallokation.
Wenn alles zusammenkommt, diese Kommentarbeiträge und die Energie und Meinungen aller Herausgeber, bin ich auch gespannt, welchen Weg wir gehen.
29. Dezember 2009 um 00:01
Vielen Dank für die Rückmeldung. Zu 2): Das System ist aber oftmals nicht mehr „running“. Die Bibiliotheken müssen reihenweise Zeitschriften abbestellen, weil die Schere zwischen sinkenden Etats und schnell steigenden Preisen immer größer wird. Ich kenne die Situation in St. Gallen nicht, aber in deutschen Uni-Bibliotheken sieht es bei abseitigeren Themen, aber auch schon bei Standardwerken oft schon sehr schlecht aus.
Zu 3): Das ist ein weites Feld. Reden wir darüber, wenn Professoren wie Fabrikarbeiter nach Stundenlohn mitsamt minutengenauer Zeiterfassung honoriert werden… dass das weder praktikabel noch für die gesteckten Ziele wünschenswert ist, dürfte klar sein.
29. Dezember 2009 um 18:42
Schauen wir uns doch mal die Zeitschrift für E-Learning genauer an.
Der Jahrgang 2007 ist als kostenloser Download verfügbar, was erfreulich ist. Hier müsste es Downloadzahlen geben.
Ein Heft kostet 15 Euro 80 bzw. bei den neueren 16,40, was bei 60 Seiten zwar nicht unhappig ist, aber nicht vergleichbar mit naturwiss. E-Journals, die im Jahr soviel wie ein Mittelklassewagen kosten.
Viele vergleichbare Zeitschriften zum E-Learning gibt es nicht, niemand stößt da an seine finanziellen Grenzen, wenn E-Learning sein Hauptinteressensgebiet ist.
Wir halten fest: Im konkreten Fall von einer „Zeitschriftenkrise“ zu sprechen wäre absurd (für die Schweizer Rechtswissenschaft wurde auf den Konstanzer OA-Tagen 2009 ebenfalls dargestellt, dass es da keine Krise gibt und alle zufrieden sind.)
Was ist aber mit denen, die sich für E-Learning interessieren, aber kein Abo und auch keinen Einzelerwerb wollen (z.B. weil sie ein Zitat für einen Aufsatz benötigen und da kauft niemand alle 50 oder 100 Aufsätze, die er dafür mindestens lesen muss)?
ZDB weist auf den ersten Blick eine stattliche Zahl von Bibliotheken nach, die die Zeitschrift führen. Aber wie sieht es bei näherem Hinsehen aus? In Aachen gibt es keinen Nachweis, die UB Freiburg hat sie nicht, ich müsste (wohne in Neuss, arbeite in Aachen) nach Düsseldorf fahren. Köln hat sie nicht, Tübingen hat sie nicht.
Wegen einem Aufsatz wird man sich vernünftigerweise als Benutzer der UB Freiburg nicht auf den Weg zur PH Freiburg machen, wo sie vorhanden ist. Das kostet Benzin/Straßenbahnkosten, vor allem aber Zeit. Wer ein bisschen betriebswirtschaftlich denkt, nimmt die Fernleihe oder SUBITO in Anspruch.
Wenn ichs recht verstehe, kostet ein Aufsatz aus der Zeitschrift bei SUBITO 4 Euro, da der Verlag kein Lizenzentgelt erhält.
Fernleihgebühr ist in NRW üblicherweise 1,50 Euro. In der Schweiz liegen diese höher, wie ich einem aktuellen Blogeintrag entnehme: “Durch den Einsatz der Studierendenschaften von Bern (SUB), Basel (SKUBA) und Luzern (SOL) kommt der Bibliotheksverbund IDS den Studierenden entgegen und senkt auf Dezember die Gebuehren fuer den Buecherkurierdienst zwischen Bern, Basel, Luzern, Zuerich und St. Gallen von 7.- auf 5.- Franken pro Medium.”
Inwieweit SUBITO tatsächlich subventionsfrei arbeitet, was Bibliotheksdienstleistungen angeht, weiß ich nicht – die Fernleihe tut es nicht. Die öffentliche Hand kauft die Zeitschrift (hier vernachlässigbar), bezahlt Mitarbeiter, die den Band transportieren (im Haus und im Bücherauto), ihn kopieren/scannen, die Bestellung bearbeiten. Zu DM-Zeiten war eine Fernleihtransaktion mit realen Kosten von 40 DM zu haben, erinnere ich mich.
Billiger kommt es den Staat, wenn der Nutzer den Autor um eine Kopie bittet. Aber erstens antworten längst nicht alle Autoren auf eine solche Bitte (ich sehe mal davon ab, dass mir neulich eine Anwältin keine Kopie ihres jur. Beitrags aus urheberrechtlichen Gründen zur Verfügung stellen wollte!) und zweitens ist die übersandte EDV-Version oft nicht zitierfähig, da der Autor kein Verlags-PDF hat. Wie oft Autoren solche Anfragen erhalten, wäre von den Herausgebern zu klären.
Halten wir aber mal fest: Die deutsche Fernleihe ist hochsubventioniert. Private und universitäre Nutzer können dank erheblicher finanzieller Aufwendungen der öffentlichen Hand ein inzwischen doch sehr effizientes Literaturversorgungssystem nutzen, das bei gedruckter Literatur gut funktioniert.
Dem Verlag kann es egal sein, wenn ein Bedarf über den Einzelverkauf/Abo hinaus besteht, der zum kleinen Teil durch Einzelinitiative (ich fahr mal nach Düsseldorf, mail den Autor an), zum größeren Teil aber von der öffentlichen Hand finanziert wird.
Sollte das aber auch den Herausgebern egal sein?
Immaterielle Schäden und damit in Verbindung stehende volkswirtschaftliche Kosten (wenn Wissenschaft/Praxis nicht so gut ist, wie sie sein könnte) sind sehr viel schwerer oder kaum messbar:
Niemand liest in der dritten Welt eine deutschsprachige E-Learning-Zeitschrift, das können wir vernachlässigen. Wenn aber im Jahr tausende Menschen sterben, weil die Ärzte nicht an die teuren medizinischen Fachinformationen herankommen, dann zeigt das auch eine ethische Relevanz von Open Access auf.
Schaden: Wissenschaftler/E-Learning-Praktiker werden auf relevante Artikel nicht aufmerksam, weil das kostenlose Abstract oder der Eintrag der Titeldaten nicht genügt. (Mir selber passiert es nicht selten, dass ich via Google Books auf Treffer stoße, die in meiner eigenen Bibliothek stehen, an die ich aber nicht gedacht hätte.) Wieviele Wissenschaftler tragen einen neuen Artikel mit passenden Schlagworten brav in ihre Literaturverwaltung an, wenn sie ein neues gekauftes Zeitschriftenheft bekommen? Zitiert wird dann oft nur, was andere schon zitiert haben. OA-Artikel werden aber nachweislich deutlich mehr zitiert.
Schaden: Randnutzer aus anderen Disziplinen/Interessensgebieten nehmen Artikel nicht zur Kenntnis, weil sie von einer Beschaffung (Kauf, Einsichtnahme, Fernleihe) absehen. Interdisziplinarität bleibt so auf der Strecke, denn jede Kenntnisnahme von Literatur außerhalb des eigenen Fachgebiets, soweit sie nicht bequem via Internet realisiert werden kann, kann, wenn nicht (meist vom Staat bezahlte) Hilfskräfte einem alles abnehmen, sehr lästig sein (Aufsatz oder Buch aus dem Magazin bestellen, in einer Institutsbibliothek einsehen, Anstehen am Kopierer, der manchmal kaputt ist, usw. usf.).
Diese Faktoren gehören zur Ökonomie des wissenschaftlichen Arbeitens dazu!
29. Dezember 2009 um 20:45
Danke, Herr Graf für diese detaillierten Überlegungen, Recherchen und Fakten. Ich habe auch Ihre im anderen Kommentar verlinkten Posts gesichtet. All diese Argumente kommen mit an den Tisch.
1. Januar 2010 um 18:13
> Dr. Klaus Graf schrieb:
> [..] nicht vergleichbar mit naturwiss. E-Journals,
> die im Jahr soviel wie ein Mittelklassewagen kosten.
Wo gibt es denn Mittelklasssewagen für 3000 USD? Den muss ich mir unbeding besorgen! – bzw. in welcher Welt lebt Herr Graf?
1. Januar 2010 um 18:32
Open Access ≠ Free
(Green vs. Gold OA)
(see for instance BioMed Central, PLoS, MDPI, Hindawi, Co-Action, Oxford Open, SAGE, Libertas, Bentham, and many others… or simply have a look at [1])
Even if Bill Hooker and others found that more than 50% of OA journals listed in the DOAJ did not charge publishing fees, one has to be sceptical about theses results [2]. It would be more meaningful to correlate the „charges fees“ vs. „does not charges fees“ question with the number of articles actually published by each journal. Those journals that do not charge are not always to be taken too seriously, i.e. only 38% of the DOAJ-listed journals have the techincal capacity and resources to deliver abstracts [3]. I guess no decent scientist wants to publish in this journal, for example, even if it does not charge fees: http://sbe.balikesir.edu.tr/dergi/
1. http://www.biomedcentral.com/info/authors/apccomparison/
2. http://blogs.law.harvard.edu/pamphlet/2009/05/29/what-percentage-of-open-access-journals-charge-publication-fees/
3. http://www.doaj.org/ (There are now 4535 journals in the directory. Currently 1759 journals are searchable at article level.)
12. Januar 2010 um 17:47
[…] Wenn ich die ausführlichen Beiträge von Gabi Reinmann (”Wer zahlt?”) und Andrea Back (”Toll ein anderer zahlt – Open Access gibt es nicht ohne Finanzierungsmodell”) richtig gelesen habe, fehlt es nicht am Willen, sondern an Ideen, so dass man das Problem erst […]