Als Mitherausgeberin einer wissenschaftlichen Zeitschrift ZEL (Zeitschrift für E-Learning, Lernkultur und Bildungstechnologie), die der Studienverlag in vier Themenheften pro Jahr im Druck produziert und vertreibt, befasse ich mich mit der Frage, wie ein „Open Access„-Modell umgesetzt werden kann. Dass die wissenschaftlichen Artikel entgeltfrei, online und sofort mit ihrem erstmaligen Erscheinen zur Nutzung verfügbar sind, wird als Erwartung an uns Herausgeber herangetragen, teils verbunden mit Enttäuschung oder sogar Entrüstung, dass dies zur Zeit nicht selbstverständlich der Fall ist.
Natürlich ist es erstrebenswert, dass die Nutzung von Bildungsressourcen mit möglichst geringen Barrieren und idealerweise unentgeltlich möglich ist – und wo immer mir das leicht möglich ist, mache ich aktiv mit (meine Blogposts, Präsentationen auf Slideshare, Projektberichte auf Calameo, Wissenscommunities wie WissensWert Blog Carnival u.a.m. sind frei verfügbar).
Hinter jedem Produkt steht jedoch ein Produktionsprozess, der Kosten und Zeitaufwand verursacht – und eine wissenschaftliche Zeitschrift ist nicht kostenlos machbar, selbst wenn die Arbeit von Herausgebern, Autoren und Gutachtern ohnehin schon ohne spezielle Vergütung, „ehrenhalber“ geleistet wird. Kosten müssen durch Erlöse mindestens gedeckt werden, sonst kann das Produkt über kurz oder lang nicht mehr angeboten werden. Wenn die Erlöse nicht von Abonnement-Einnahmen kommen, dann müssen es andere Erlösquellen sein, mir fallen ein: Spenden, Sponsoring, indirektes Sponsoring durch Mischkalkulationen, Werbeeinnahmen, Mitgliedsbeiträge bei Zeitschriften von Fachgemeinschaften, Pay-per-View-Modelle, Einreiche- und Publikationsgebühren für die Autoren. Traditionell übernimmt ein Verlag die unternehmerische Aufgabe und das Risiko, Kosten und Erlöse mindestens zur Deckung zu bringen. Ausserdem steht der Verlag auch für Rechtsfolgen ein, wenn das nicht gelingt; der Verlag ist auch Organisator und Anspruchsgegner in rechtlichen Belangen.
Wenn ein Verlag nun nicht auf das Open Access Modell einsteigen will, wie soll dann der Herausgeberkreis den Leserinnen und Lesern entsprechen, die unentgeltliche Nutzung fordern? Entweder a) man findet einen anderen Verlag, der in Open Access eine Marktchance sieht, zahlt für die Zeitschrift eine Ablösesumme oder man gründet neu. Vielleicht b) übernimmt man dann selbst das Verlagsgeschäft. Oder c) man beschafft das Geld für den Verlag, damit dieser bereit ist, Open Access zu publizieren, wenn es zu entgangenen Erlösen und Zusatzaufwand kommt. Wer wird unumwunden für b) oder c) votieren, wo die Aufgabe der wissenschaftlichen Herausgeber doch ist, für die Inhalte und deren Qualität besorgt zu sein und sich nicht mit Operativem herumschlagen zu müssen?
Man könnte noch d) hinzufügen, dass die Bedeutung der Openness-Bewegung überhaupt darin zu sehen ist, die Publikation und Kommunikation wissenschaftlicher Erkenntnisse grundlegend zu innovieren, d.h. das Modell wissenschaftlicher Zeitschriften der heutigen Prägung wäre überhaupt in Frage zu stellen. Ja, die Strategiegestaltung und Innovation liegt in der Verantwortung der Herausgeber. Das sei jedoch jetzt noch nicht weiter ausgeführt, denn Auslöser meines Blogposts hier sind nicht eine Fülle von Ideen von Leser/inn/en und Autor/inn/en, was zu verbessern wäre, sondern es ist der Anspruch „entgeltfreie Nutzung“.
Aber nun zu der Kostenstruktur: Eine wissenschaftliche Zeitschrift ist ein Produkt, hinter dem ein recht komplizierter Wertschöpfungsprozess steht, an dem mehr Beteiligte mitwirken als man auf den ersten Blick denkt. Die nicht eigens vergüteten Organisationsleistungen der Herausgeber für die Zeitschrift sind beträchtlich. Weiterhin durchläuft jeder einzelne – auch nicht-veröffentlichte – Artikel einen arbeitsaufwendigen ebenfalls ohne separate Vergütung erbrachten Veredelungsprozess (Verfassen der Beiträge – Auswahlprozess unter Einreichungen von Abstracts – Begutachtung i.V.m. Verbesserungshinweisen durch mehrere Personen – Sichtung der überarbeiteten Version und schliesslich das Management eines Heftprojekts als solches); wissenschaftliche Artikel sind also nicht damit vergleichbar, einen Blog-Post zu schreiben oder Vortragsunterlagen auf einer offenen Plattform verfügbar zu machen. Es gibt bezahlte Dienstleistungen in diesem Prozess (Website/Webplattform betreuen, redaktionelle Überarbeitung der Beiträge inkl. ansprechendes Layout, Marketing für die Zeitschrift, allg. Sekretariatsarbeiten und Reisespesen), die dazu führen, dass man im Fall von Autorengebühren-Modellen kalkuliert, dass ein Artikel einige wenige Hundert bis 2000 EUR kosten müsste. Das klingt nach nicht viel Zusatzaufwand für die Herausgeber, dies auch noch zu besorgen. In der Praxis heisst dies aber oft, man muss zum einen an der eigenen Hochschule Zusatz-Budgets für diese Dienstleistungen heraushandeln und zum anderen Anerkennung für diesen Zeitaufwand gewinnen, denn der Druck auf Hochschullehrer, die Zeit in eigene Journalpublikationen und Forschungsmittel-Akquise zu investieren führt zu um die Zeitressourcen stark konkurrenzierenden Anforderungen.
Mein Stand des Denkens: Verlage und Herausgeber müssen mit der Zeit gehen und auch mal experimentieren, um Systemveränderungen einzuleiten; aber sie sollen auch nichts überstürzen, insbesondere nicht die kaufmännische Sorgfalt ausser Acht lassen. Sonst geht die Zeitschriftenkrise bei den Printpublikationen nahtlos in eine Open-Access-Zeitschriftenkrise über. Solange das Konzept „Open Access“ hauptsächlich im Sinn von „toll ein anderer zahlt und macht“ (Anm. Team-Arbeit wird spöttisch oft als toll-ein-anderer-machts interpretiert) gefordert wird und nicht so verstanden wird, dass ein komplexes Gefüge wie das wissenschaftliche Publikationswesens, inklusive dessen Rolle in der Qualifizierung für wissenschaftliche Karrieren, zeitgemäss und stimmig neu gestaltet werden muss, bevorzuge ich, schrittweise, mit Bedacht und mit kaufmännischer Vorsicht vorzugehen. Schrittweise, weil ich David Wileys Artikel „Defining Open“ auf seinem Blog „iterating toward openness – pragmatism over zeal“ zustimme, dass Openness nicht heisst, entweder offen oder geschlossen, sondern es sich so verhält wie bei einer Türe, die mehr oder weniger offen stehen kann. Auch kann man eine Entwicklung beobachten, dass in der Wissenschaft besondere Leistungen separat vergütet werden sollen, so dass die „unentgeltlichen“ Arbeiten in der Organisation des wissenschaftlichen Publizieren vielleicht zurückgehen werden. Und schliesslich wird das Prinzip der kaufmännischen Vorsicht aus meiner betriebswirtschaftlichen Ausbildung meiner Überzeugung nach auch im Zeitalter des Offenen Internet noch gelten, auch wenn ich mit dem Beitrag von Google „The Meaning of Openness“ (vom 21.12.09) übereinstimme, in dem es u.a. heisst, dass das MBA-Curriculum neu geschrieben werden würde.
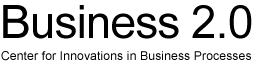

 Beiträge per RSS
Beiträge per RSS